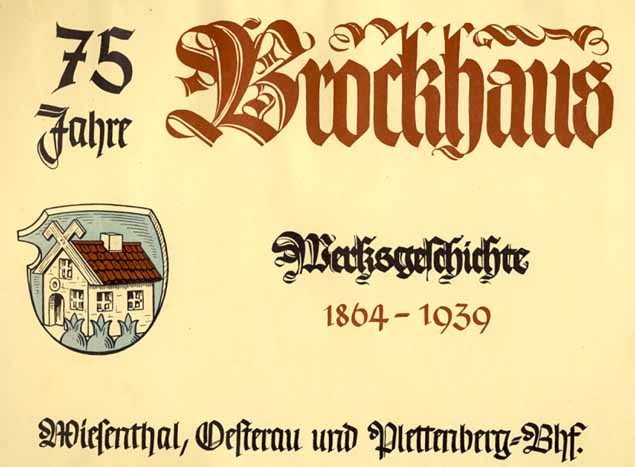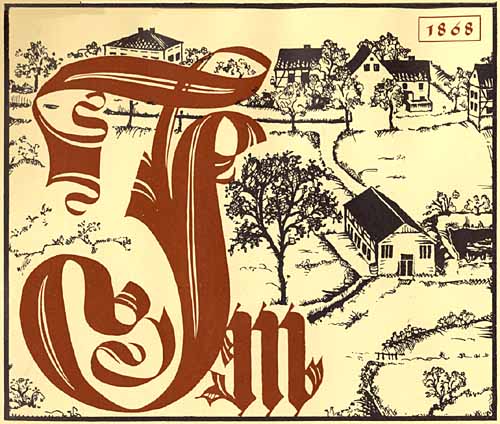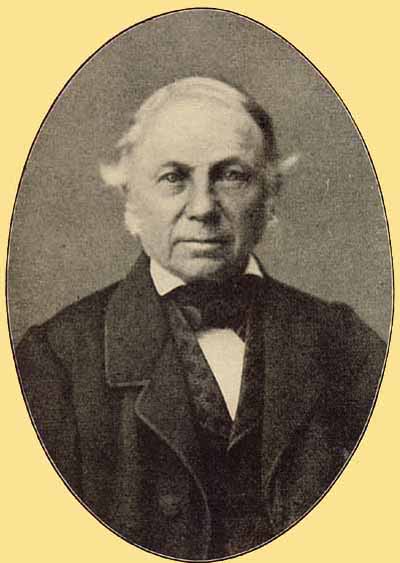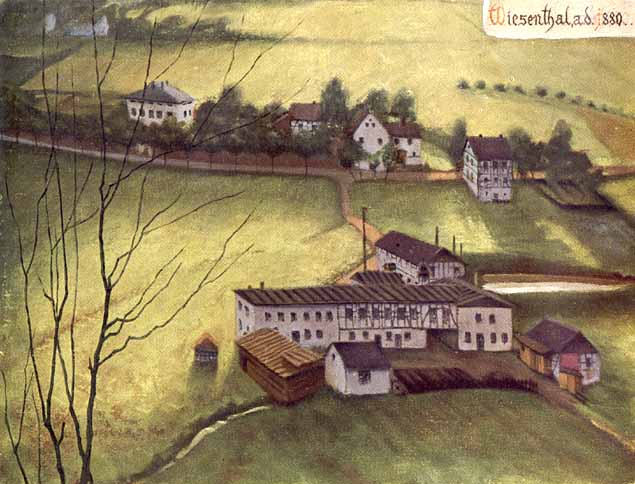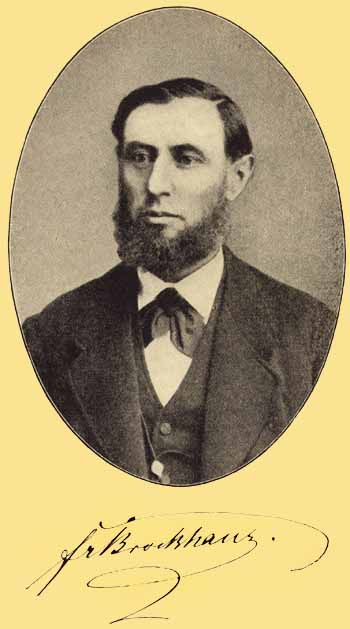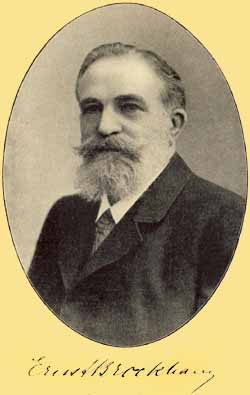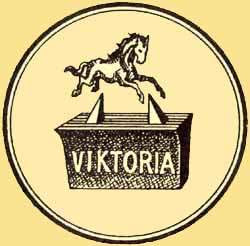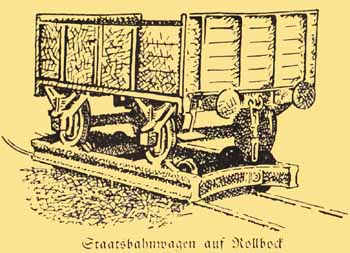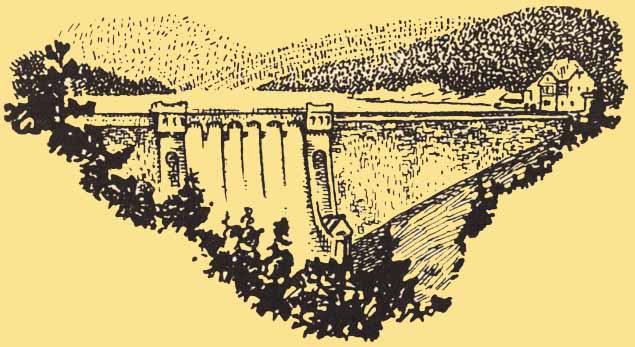|
Quelle: Festschrift zum 75-jährigen Bestehen der Fa. Brockhaus Söhne
Inhaltsverzeichnis
Erster Teil
Zweiter Teil
Jahre 1939 sind 75 Jahre verflossen seit den Anfängen der Firma
Friedrich Brockhaus in Wiesenthal; 1872 ging aus ihr die Firma
F. & E. Brockhaus und 1880 die Firma Ernst Brockhaus & Co
hervor. Diese wurde im Jahre 1900 in eine Gesellschaft mit
beschränkter Haftung umgewandelt. Die Firma Paul Brockhaus
in Oesterau ist die Nachfolgerin
der 1874 gegründeten Firma Julius Brockhaus & Co, Kom.-Ges.,
Oesterau und Milspe; sie blickt also heute auf eine 65-jährige
Vergangenheit zurück. Im Jahre 1922 wurde die Firma ebenfalls
in einer G.m.b.H. umgeändert. Seit 1919 sind beide Firmen mit
den 5 Werken Wiesenthal, Lettmecke und Plettenberg-Bahnhof
sowie Oesterau Abt. I und Abt. II unter eine einheitliche
Leitung gestellt. Für diesen Zweck wurde die offene Handelsgesellschaft
Brockhaus Söhne mit dem Sitz in Oesterau gegründet, die
im Jahre 1930 auch die Maschinen und Einrichtungen übernahm.
Ein kurzer Auszug aus der 1928 im Verlag F. A. Brockhaus in
Leipzig erschienenen "Geschichte der Familie Brockhaus aus
Unna in Westfalen" mag einiges über die Vorfahren der in dieser
Werkschronik behandelten Personen berichten.
Die Wiege des Geschlechts stand auf dem ursprünglich zum
Stift Essen gehörigen freien Reichshof Brockhausen bei Unna.
Um die Mitte des 16. Jahrhdt. verließen die Brockhaus den Hof
und widmeten sich mehr städtischen Berufen; es finden sich
Kaufleute, Ratsherren und Rechtsgelehrte, insbesondere aber
auch Pastöre und Lehrer darunter.
Als Stammvater der Plettenberger Linie ist der Pastorensohn
Hermann Eberhard Brockhaus zu bezeichnen, der von 1691 bis 1707
Pastor in Plettenberg war. Sein Bruder Heinrich, 1699 bis 1724
Pastor in Soest, ist Stammvater der Leipziger Linie. In
Plettenberg waren die weiteren Vorfahren Meister, Vorsteher
und Rechnungsführer der Tuchmacherzunft. Johann Hermann
Jonathan Brockhaus, der Sohn des vorerwähnten Plettenberger
Pastors, war Teilhaber einer "Strumpf-Fabrique" in Plettenberg,
die unter dem Namen "Adell, Brockhaus und Konsorten" betrieben
wurde. Die Fabrik war 1729 gegründet und beschäftigte 1788
an 9 Stühlen 27 Arbeiter. Sein Sohn Johann Adolf Leopold
übernahm die Geschäfte, und sein Enkel Christoffel Friedrich
ist nach allen Nachrichten ein erfolgreicher Unternehmer
gewesen.
Zwei Söhne von Friedrich Wilhelm Brockhaus wurden die Begründer der
Fabriken in Wiesenthal, Milspe (jetzt Ernst Löwen) und Oesterau;
seine Enkel und Urenkel führten die Werke weiter, während heute
teilweise schon die vierte Generation in der Firma Brockhaus
führend tätig ist.
Geschichte der Werke Wiesenthal, Oesterau und Lettmecke 1864 - 1924
Friedrich (Fritz) Brockhaus war als dritter Sohn des Lehrers
Friedrich Wilhelm Brockhaus in Himmelmert bei Plettenberg am
15. September 1828 geboren. Nachdem er seinen bisherigen
Lehrerberuf 1863 aufgegeben hatte, gründete er im Jahre 1864
ein "Fabrikgeschäft" mit einigen Webstühlen zur Anfertigung
von Eisen- und Messingdrahtgeweben und daraus hergestellten
Drahtwaren.
Ernst Brockhaus war geboren am 27. Dezember 1848 als
ältester Sohn des Hauptlehrers Karl Brockhaus in Elberfeld
und hatte nach dem Besuch des dortigen Gymnasiums eine
gute kaufmännische Ausbildung genossen.
Durch den allgemeinen Niedergang des Jahres 1873 in der
ganzen Geschäftswelt Deutschlands wurde natürlich auch
die neue Firma in Mitleidenschaft gezogen, und es traten
in den folgenden Jahren schwere Verluste ein. Die
Drahtgewebeherstellung ging infolge der standortlich
viel günstiger gelegenen Konkurrenz so stark zurück,
dass man sich nach neuen Artikeln umsehen musste.
Weder die Aufnahme von Splinten noch ein Kommissionsgeschäft
brachten jedoch den gewünschten Erfolg, so dass man
schließlich 1876, wie bereits 2 Jahre vorher in Oesterau,
ein paar Fallhämmer anschaffte, unter denen zunächst
kleine Ofenbeschlagteile angefertigt wurden. Da die Bilanz
jedoch immer noch keinen Gewinn aufwies, trat Fritz
Brockhaus nach Verhandlungen mit den Kommanditisten am
1. Juli 1877 von der Geschäftsführung zurück, und Ernst
Brockhaus (*27.12.1848 †04.06.1915) übernahm die Leitung allein. Er baute die
Gesenkschmiede weiter aus und stellte zu deren Betreuung
1879 einen Techniker Wilhelm Damm ein, der den Betrieb
bis zum Jahre 1905 geführt hat. Als langjähriger treuer
Mitarbeiter ist auch Fritz Wiegand zu erwähnen, der von
1883 bis 1930 als Meister, später Obermeister, tätig war.
Am 1. März 1880 schied Friedrich Brockhaus endgültig aus dem
Geschäft aus; Ernst Brockhaus übernahm es und führte die
Firma unter dem Namen Ernst Brockhaus & Co allein weiter.
In der Folge wurden weitere Artikel aufgenommen wie Schienenlaschen
und Feldbahn-Klemmplatten, die bislang aus Temperguss hergestellt
worden waren. Zu guten Preisen wurden bald bedeutende Umsätze erzielt, und
die Klemmplatten haben nicht wenig zur weiteren Entwickelung des
Unternehmens beigetragen, bis der Artikel in späteren Jahren
unlohnend wurde. - Im Jahre 1882 kamen Nähmaschinenteile hinzu,
die Ernst Brockhaus 1884 mit großem Erfolg auf der Nähmaschinen-Ausstellung
in Hannover zeigte. - Sehr bald schlossen sich auch Fahrradteile an,
welche die damals aufstrebende Fahrradindustrie, besonders seit der
1886 stattgefundenen Fahrrad-Ausstellung in Leipzig, in steigendem
Maße bezog. Die Belieferung dieses Industriezweiges machte um
die Jahrhundertwende etwa 80 Prozent des gesamten Umsatzes aus.
Ernst Brockhaus hat durch die Herstellung der genannten Artikel
als Gesenkschmiedestücke in Deutschland bahnbrechend gewirkt und
insbesondere zur Verdrängung der bislang führenden englischen
Konkurrenz wesentlich beigetragen. Sogar das Ausland wurde Abnehmer
der deutschen Ware, und besonders zu Fahrradteilen war bald ein
nicht unbedeutender Export zu verzeichnen.
Infolge dieser Entwicklung wurde der ganze Betrieb auf die Herstellung
von Schmiedestücken eingestellt, nachdem die Drahtwaren 1885 aufgegeben
waren. Bereits 1872/73 hatte Ernst mit Hilfe seines Schwiegervaters
aus Rotterdam ein für die damaligen Verhältnisse übergroßes Wohnhaus
gebaut, doch fehlte ihm jetzt das Kapital, um den Betrieb gemäß den
gestiegenen Anforderungen zu vergrößern. Abermals kamen ihm seine
holländischen Verwandten zu Hilfe, und so entstand 1888 an Stelle
der Drahtrolle der erste größere Schmiedeneubau, in dem sogar von
1888 bis 1895 in Doppelschicht gearbeitet werden musste. Steigende
Umsätze und Gewinne gestatteten bald weitere Vergrößerungen: 1892
folgte ein Anbau, 1894 eine neue Schmiede von 40 Meter Länge und
1895 ein Bau für die Gesenkschlosserei. 1896 musste die neue Schmiede
weiter vergrößert werden. - Trotz dieser starken Bautätigkeit konnte
Ernst bis 1898 alle Schulden mit Zinsen zurückzahlen.
Im Jahre 1900 zog sich Ernst Brockhaus von den Geschäften zurück,
siedelte nach Elberfeld über und übergab seinen beiden ältesten
Söhnen Walther und Julius Brockhaus die Führung. Zugleich wandelte er
die Firma in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung um, mit einem
Stammkapital von M. 400.000, wovon Ernst Brockhaus M. 350.000 und
seine Söhne je M. 25.000 übernahmen.
Walther Brockhaus war am 1.8.1874 als ältester Sohn von Ernst Brockhaus
in Wiesenthal geboren, hatte nach dem Besuch der Oberrealschule in
Elberfeld eine kaufmännische Lehre durchgemacht und weilte 1 Jahr zur
Ausbildung in der Schweiz. - Sein am 14.10.1875 geborener jüngerer
Bruder Julius besuchte das Realgymnasium zu Elberfeld und nach
praktischer Ausbildung die Maschinenbauschule in Köln. 1895/96 war er
zur weiteren Ausbildung in Sheffield.
Die bisher fast ausschließliche Beschäftigung in Fahrradteilen flaute
im ersten Jahre der G.m.b.H. ganz plötzlich ab, da die Konjunktur in
der Fahrradindustrie außerordentlich nachließ; es mussten infolgedessen
abermals neue Artikel gesucht werden. Vor allem wurden Gesenkschmiedestücke
für den Eisenbahn-Signalbau, Schmiedezangen, Transportösen, Spezialschlüssel
und sonstige Werkzeuge aufgenommen.
Seit Beginn der Automobil- und Motorrad-Industrie war es eine natürliche Folge,
dass auch gesenkgeschmiedete Konstruktionsteile für die Kraftfahrzeugbranche
hergestellt wurden, um so mehr, als die betreffenden Firmen zumeist schon seit
Jahren treue Abnehmer in Fahrradteilen waren.
Im Jahre 1903 wurde endlich die lang ersehnte Oestertalbahn bis Oesterau und
Wiesenthal erbaut, die letzte 2 1/2 km lange Strecke mit drei Brücken über
den Oester- und Ebbeckebach auf eigene Kosten. Bis dahin waren alle Waren auf
schlechten Straßen mit Fuhrwerk befördert worden, womit bis zu 10 Pferde
tagaus tagein beschäftigt waren. Die Talbahn bedeutete eine große Erleichterung,
und obwohl die Frachtkosten nicht günstiger waren als die des Fuhrwerks, hat
sie bei der weiteren Entwicklung der Betriebe unentbehrliche Dienste geleistet.
Auch die von den Anliegern des Ebbecke- und Oesterbaches seit langem geplante
Talsperre wurde von 1904 bis 1906 gebaut, so dass auch in trockenen Sommermonaten
kein Wassermangel mehr zu befürchten war. Jetzt konnte auch ein Ausbau der
Wasserkräfte in Wiesenthal und dem späteren Kaltwalzwerk Lettmecke erfolgen.
Die schwierigen Arbeiten wurden 1906-07 von Walther Brockhaus in eigener Regie
durchgeführt mit einem Gesamtkostenaufwand von rd. RM 250.000. Die beiden
Turbinenanlagen erzeugen eine Kraft von 150 bzw. 180 PS.
Um eine regelmäßige Beschäftigung der Hämmer auch in den stillen Monaten sicherzustellen,
versuchte man das Herstellungsprogramm um einige Lagerartikel zu erweitern. Im
Jahre 1908 gelang es, einen Mobilmachungsvertrag über die Lieferung von fertig
bearbeiteten Militärhufeisen abzuschließen, die auch schon in Friedenszeiten in
ansehnlichen Mangen abgenommen wurden. Als weiterer Lagerartikel kam die Gleitschutzkette
"Start" für Lastwagen hinzu, während gleichzeitig neue Abnehmer für Gesenkschmiedeteile
in der optischen Industrie und im Schiffbau gefunden wurden. Die Beteiligung an der
Weltausstellung in Brüssel 1910 brachte außer der Verleihung eines Grand-Prix und
verschiedener Medaillen neue Kundenverbindungen und Aufträge.
(wird fortgesetzt) |