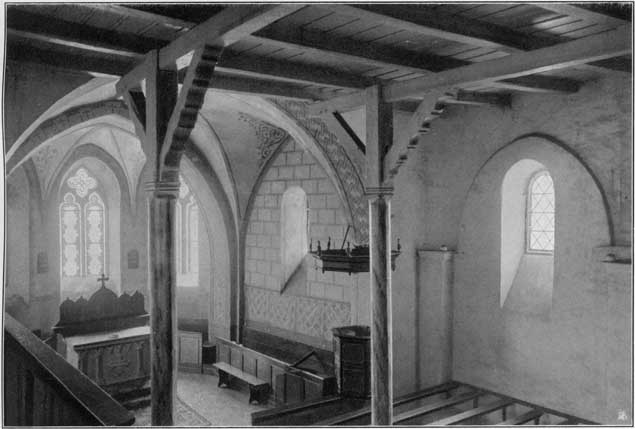|
Quelle:
Süderländer Tageblatt vom 22.08.1957
Bald ertönen die neuen Glocken vom Böhl Plettenberg. Vom Turm der Böhler Kirche werden in einem
Monat wieder die Glocken zum Gottesdienst rufen. Seitdem die letzten
Glocken der Böhler Kirche im zurückliegenden Krieg abgeliefert werden
mussten und nach Ende des Krieges nicht mehr aufzufinden waren, ging der
Wunsch der evangelischen Kirchengemeinde dahin, auch für dieses schöne
alte Kirchlein wieder ein eigenes Geläut zu bekommen.
Vor einigen
Monaten wurde eine Spendenaktion in die Wege geleitet. Der Appell fand
offene Herzen und die Glocken konnten wenig danach beim Bochumer Verein
in Auftrag gegeben werden. In diesen Tagen werden nun die Glocken fertig.
Bereits am 7. September, also in nicht ganz drei Wochen, wird in
festlicher Form ihre Einholung nach Plettenberg erfolgen. Zwei Tage
später wird dann das Aufziehen der Glocken und ihre Montage im Turm
beginnen. Die Vorarbeiten
für diese Montage haben in der Böhler Kirche bereits begonnen. Da die
Glocken auf Grund ihres großen Gewichtes und Umfanges nicht auf dem
normalen Weg in den Turm gebracht werden können, muß an dem Gotteshaus
ein Gerüst errichtet werden. Außerdem ist zur Einbringung der Glocken in
die Kirche ein Durchbruch durch das Mauerwerk unterhalb des Turmes
erforderlich.
Nach Einholung
und der Montage wird am 29. September die festliche Weihe der drei neuen
Kirchenglocken erfolgen und zweifellos zu einem Höhepunkt in der
Geschichte der Plettenberger evangelischen Kirchengemeinde werden.
Gleichzeitig bedeutet dieser Festtag ein Markstein in der so
wechselvollen Geschichte des Kirchleins, das, im Mittelalter einst als
Hospital für Aussätzige entstanden, später zu einer Kapelle und in
jüngster Zeit zur Kirche ausgebaut wurde und schon wiederholt im Laufe
seines Bestehens sein Geläut eingebüßt hat.
Die neuen
Glocken werden, wie kürzlich schon berichtet, in den Tönen "es - ges -
as" erklingen. Die größte der drei Glocken, die es-Glocke, wird einen
Durchmesser von 1.425 mm und eine Höhe von 1.295 mm und ein Gewicht von
1.080 kg aufweisen. Allein der Klöppel dieser großen Glocke wird 75 Kg
wiegen.
#
Böhler Kapelle
Quelle: Quellen zur Geschichte der Stadt Plettenberg, Bd. 1, S.223,
lt. Veränderungsnachweis zum Lagerbuch der evgl. Kirchengemeinde zu
Plettenberg für den Zeitraum vom 1. April 1908 bis 1. April 1911
Die Böler Kapelle
Die Böler Kapelle wurde im Jahre 1908 durch den Kirchenbaumeister Hofmann
in Herborn umgebaut. Der Umbau des Gebäudes bildet einen Anbau nach Norden
zu, in welchem Seitenschiff, Turm und Sakristei liegen. In jenem Seitenschiff
ist dann auch eine neue, tiefe Seitenempore eingebaut, welche mit der
Orgelbühne (Kopfempore) im alten Baiteil verbunden ist. Während die alte
Kapelle ungefähr 200 Sitzplätze hatte, weist die jetzige Kirche 510 feste
Sitzplätze auf.
Ohne den ebenfalls neu errichteten aus Holzfachwerk bestehenden Vorbau am
Westgiebel hat das erweiterte Bauwerk bis zum Chorabschluss eine Tiefe von
20,5 Meter. Die größte Breite beträgt 17,6 Meter. Die Umfassungsmauern der
Kirche bestehen aus Bruchsteinen; die Umrahmungen der Türen und Fenster
sind aus Trachitwerksteinen gefertigt. Die Dächer wurden auf Holzverschalung
beschiefert. Der alte Chorteil, aus dem Mittelalter stammend, zeigt massives
Gewölbe, während der übrige Kirchenraum mit Holzdecke überspannt ist.
Die Kirche wird durch eine kleine Luftheizung erwärmt, deren Heizkammer
zwischen dem neuen Turm und dem alten Chor eingebaut ist. Das jetzt vorhandene
3-stimmige Geläute ist von mittlerer Größe und hängt in einem eisernen
Glockenstuhl. Die beiden neuen Glocken sind von der Firma Rincke in Sinn (?)
gegossen worden. Das Gebäude ist mit Zubehör jetzt zu 60.000 M. seit 25.05.1909
bei der Westfälischen Provinzial Feuer-Sozietät versichert.
Quelle: Internet "http://www.ich-geh-wandern.de/christuskirche-plettenberg"
. . . Vom Stadtzentrum aus südlich liegt auf einer kleinen Anhöhe die Böhler Kapelle. Ursprünglich
gab es rund um Plettenberg ein ganzes Dutzend dieser kleinen Andachtsstätten, doch von
diesen ist heute nichts mehr sichtbar. Nur die Böhler Kapelle blieb übrig. Die erste
Kapelle an dieser Stelle war schon Mitte des 12. Jahrhunderts vom damaligen Kölner Erzbischof
Friedrich II. gestiftet worden. Das heutige Gebäude entstand 1422. Es handelt sich dabei um
einen schlichten, barock erweiterten Saalbau mit trapezförmigem Grundriss. Der Turm entstand
allerdings erst deutlich später, nämlich 1907.
Quelle: Internet http://www.meiritz.de/Regionen/MK/Plettenberg/plettenberg.html
Quelle: Heimatblätter des mittleren Lennegebietes (Beilage zum Süderländer Volksfreund),
Nr. 6, Werdohl, 17.01.1925
Die Kapelle auf dem Böle zu Plettenberg
2. Teil
Es zeigt den Chorraum fast vollständig. Entsprechend dem hohen Alter von 500
Jahren ist er im Verhältnis zu seiner Breite außergewöhnlich niedrig. Seine
Deckenwölbung wirkt angenehm. Im 3/8-Chorschluss hat er freundliche, spitzbogige,
zweiteilige Maßwerkfenster, deren angenehmes Gelb durch andere Farben kunstvoll
abgetönt war, so dass eine vorzügliche Lichtwirkung bestand. - Die übrigen
Fenster und der Triumphbogen sind rundbogig, die mit säulenartigen Vorlagen
verbundenen Wandblenden waren spitzbogig. Diese Verbindung der frühgotischen
mit dem romanischen Baustil wirkte recht vorteilhaft.
An Stelle des auf dem Bilde vorhandenen eigenartigen neuen Altars stand durch
das 18. und 19. Jahrhundert hindurch ein kunstvoll bemalter, alter Klappaltar,
der jetzt im Museum zu Altena aufbewahrt wird, und dessen Bild nächstens in
die Heimatblätter aufgenommen werden soll. - Die Unterseite des Kanzel-Schalldeckels
hatte als Verzierung eine fliegende, weiße Taube. Als Sinnbild des Heiligen
Geistes erinnerte sie daran, dass mit dem Beneficium St. Nikolai eine kleine,
jüngere Stiftung, das Beneficium St. Spiritus, verbunden war. - Außer der
kleinen Empore an der Nordseite, von der hier nur die vorderste Bank zu sehen
ist, war auch eine größere Empore an der Westseite vorhanden, deren Front eine
kleine Orgel zierte.
Durch die Einführung der Reformation verloren die Kapellen an Bedeutung, wurden
darum weniger genutzt und gerieten, größtenteils schon infolge der verderblichen
Kriegs- und Pestzeiten im 17. Jahrhundert in Verfall. Dass die auf dem Böle
erhalten geblieben ist, verdanken wir allein dem Umstande, dass sie einen besonderen
Vikar hatte. Dessen Einkünfte waren gering; so weit sie aus dem Beneficium St.
Nikolai kamen, betrugen sie nur 44 Rtlr.. Vikare der Böler Kapelle waren:
Weil den Lutherischen die Kirche nur von 10-3 Uhr zur Verfügung stand, und der
Pastor Thöne oft 2 Stunden lang predigte, so blieb in der Kirche nicht Zeit genug
für die Nachmittagspredigt des Vikars. Deshalb musste von 1723 bis nach Thönes
Tod der Vikar seine Predigt Sommer und Winter von 8-9 Uhr auf dem Böle halten.
Später fand hier nur noch im Sommer dieser Frühgottesdienst statt. Während der
Weihnachtsfrühpredigt brannten Wachskerzen in der Kapelle.
Außer den Vikaren wurden auch, wenigstens im 18. Jahrhundert, solche Gemeindeglieder
in dem kleinen Gotteshause beerdigt, die für die Grabstätte 5 Rtlr. bezahlten.
Als solche sind angegeben:
Diese Gräber in der Kapelle und der stille Grabesgarten neben derselben reden eine
ernste Sprache. Wie manche Träne ist dort in Liebe und Leid im Gedenken an teure
Verstorbene geflossen. Ein Geschlecht nach dem andern hat man hier zum Todesschlummer
eingebettet. Hier zeugt alles recht eindringlich von der Vergänglichkeit und
Flüchtigkeit des menschlichen Lebens, besonders wenn sich im Herbst auch die Natur
zur Ruhe rüstet...
58849 Herscheid, Tel.: 02357/903090, E-Mail: webmaster@plbg.de |