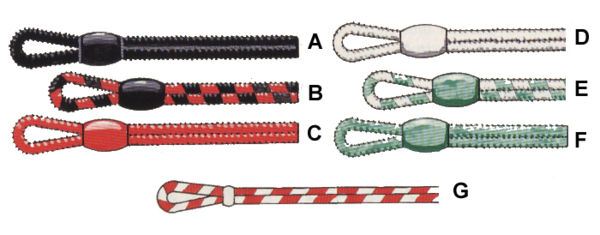|
Aus dem Bund Deutscher Mädel Quelle: Festschrift "10 Jahre Ortsgruppe Plettenberg-Stadt der NSDAP", 1936, 72 S., Archiv HH
Im Februar 1933 trafen sich zum ersten Mal 7 deutsche Mädel im
Parteilokal Heseler. Einige Tage vorher zirkulierten Listen, um
für den BDM zu werben. Obwohl eine ansehnliche Zahl zusammengekommen
war, erlebten die Gründer am ersten Abend eine Enttäuschung, denn
die vielen Bemühungen waren nicht von Erfolg gekrönt. Jedenfalls
war aber der Anfang gemacht. Dies genügte um revolutionär genug zu
sein, den gegründeten BDM zu erhalten.
Über die Aufgaben, die zu erfüllen waren, bestand noch völlige Unklarheit.
Die damalige Frauenschaftsleiterin Frau Winner hieß die Erschienenen
herzlich willkommen. Ortsgruppenleiter Menschel führte in seiner Ansprache
unter anderem aus, dass auch die deutsche Frau sowie das deutsche Mädel
Aufgaben zu erfüllen hätten, die die Bewegung an sie stellen würde und nicht,
wie die Überklugen behaupteten, dass der Führer bei der Aufbauarbeit
die deutsche Frau ausschalten würde.
Nach kurzer Zeit fand man sich wieder zusammen, jedoch in einer größeren
Anzahl. So schwer es damals erschien, alles recht durchzuführen, so stolz
kann heute der BDM auf das zurückblicken, was geleistet worden ist, denn
es gibt kaum noch ein junges Mädel in unserer Vaterstadt, das dem BDM
noch nicht angeschlossen ist.
Die Gründung:
Waltraud Steinweg wird von ihrem Schulfreund Herbert Kreft (Sohn des
Realschuldirektors) angesprochen und dringend darum gebeten, für den
"Stahlhelm" Plettenberg eine Gruppe der "Luisen" aufzuziehen. (Wann
ist unklar: schon 1931 oder gar noch früher? Spätestens 1932)
Zur Person: Waltraud Steinweg, geboren 11.03.1909, als ältestes Kind
des Rechtsanwalts Reiner Steinweg und seiner Ehefrau Ida geb. Walle.
Weitere Geschwister: Reiner geb. 1910, Günter geb. 1918. Der Vater
stammt aus einer Fabrikantenfamilie in Lüdenscheid, die Mutter ist
die Tochter von Paul Walle, Prokurist der Firma Meuser, Kaiserstraße
Ecke Herscheider Straße. Nach Meusers Tod übernimmt Paul Walle die
bankrotte Firma, die er dann seinem gleichnamigen Sohn Paul Walle
hinterlässt.
Korrektur von Jürgen Hagen: Es handelt sich bei den vier Männern auf dem Bild nicht,
wie dargestellt, um SA (Sturmabteilung), sondern um Angehörige der Fliegergruppe
Plettenberg. Von links "Heini" Greiß; Erich Hagen; Adalbert Kowalewski; der
nächste ist mir nicht bekannt. Die Bilder wurden anläßlich der Werbewoche
für die deutsche Luftfahrt gemacht. Vermutlich von Ludwig Müller selbst,
der auch zur Fliegergruppe gehörte. Mein Vater hat eine Sammeldose in der
Hand, und die Mädchen verteilten an die Spender Blumen, denn eine jede der
jungen Damen hat einen Blumenkorb an der Hand.
Reiner Steinweg (Jahrgang 1873) wird 1916 eingezogen und kehrt mit
einem Lungenschaden 1918 aus dem Krieg zurück. Der Arzt verbietet
ihm Rauchen, Alkohol und den Besuch verräucherter Lokale. Daran
hält er sich nicht, sondern stürzt sich in die politische Agitation,
ist prominentes Mitglied der DVP. Vor allem kritisiert er den
Acht-Stunden-Tag ("Nach diesem Kriegsausgang müssen wir Deutschen
arbeiten, bis uns das Blut unter den Fingern herauskommt"). Sein
engster Freund ist Landmesser Schnevoigt. Sie treten immer zusammen
auf. In der Presse und in der Polemik der SPD sind es "die beiden
Herren von Rechts".
1920 stirbt Rainer Steinweg an schwerer Tbc. Die Familie stürzt -
Freiberufler sind sozial damals praktisch nicht abgesichert - ins
Elend. Nur mit Hilfe von Verwandten kann die Witwe mit den drei
kleinen Kindern überleben. Sohn Reiner macht das Einjährige in
Plettenberg, besucht dann in Lüdenscheid das Gymnasium, wo er 1929
Abitur macht. Er studiert Jura, promoviert 1933 in Marburg und
tritt in den Dienst der Reichsbahn. Tochter Waltraud macht das
Einjährige in Plettenberg (1926), besucht danach zwei Jahre die
Handelsschule in Hagen (wohnt bei Verwandten in Hagen), tritt
danach als Sekretärin bei ihrem Onkel Paul Walle in die Firma
Meuser ein.
In seinem Lebenslauf im Anhang zu seiner Marburger Dissertation
von 1933 betont Reiner Steinweg, dass er bereits 1931 in die SA
eingetreten sei. **Von seinem Fanatismus innerhalb der Plettenberger
SA sind Episoden überliefert. Er machte sich damit während des
Referendariats Feinde bei SA-Männern, die nur aus Gründen der
Anpassung in der SA waren (nach 1933).
Die Mutter dagegen blieb eine konsequente Konservative. Von Hitler
sprach sie als von dem "Anstreicher". Sie ließ zwar ihre Kinder
bei deren Nazi-Aktivitäten im allgemeinen gewähren, stellte aber
klar, dass sie sich in den häuslichen Bereich nicht hineinreden
ließ. Von dem jüngsten Sohn Günter ist überliefert, dass er eines
Abends sehr spät von einer HJ-Veranstaltung nach Hause kam und
dafür von seiner Mutter getadelt wurde. Er antwortete: "Unser
Führer hat gesagt: Alte Steine müssen behauen werden!" Darauf
antwortete sie: "Dann will ich dir jetzt mal zeigen, wer wen
behaut" und versetzte ihm eine Ohrfeige.
Waltraud Steinweg tritt in die NSDAP sehr früh ein: im Anschluss
an eine Veranstaltung mit Parteigenosse (Pastor a. D.) Münchmeyer
am 25. September 1929, von der in der Festschrift der NSDAP
Plettenberg von 1937, S. 26, die Rede ist. Nach Schluss der
Veranstaltung konnte man auf die Bühne gehen und sich als neues
Parteimitglied eintragen. Sie tat das zusammen mit Landmesser
Schnevoigt, dem alten Freund ihres Vaters. Auf die Zustellung
des Mitgliedsbuches habe sie dann aber sehr lange gewartet -
irgendwie sei das dann wohl verbaselt worden. Erst als sie sich
dann entschloss, den BDM aufzubauen, habe sie sich darum gekümmert,
und dann auch ein Mitgliedsbuch zugestellt bekommen.
Herbert Kreft bat sie (Zeitpunkt offen, siehe oben), eine
Plettenberger Gruppe der "Luisen" aufzubauen. Sie entschied sich
stattdessen für den Aufbau einer BDM-Gruppe. Nachdem sie diesen
Entschluss gefasst hatte, schrieb sie einen Absagebrief an den
"Stahlhelm": sie (die Adressaten) seien überzeugte Frontsoldaten,
ihr Vater aber sei an den Folgen des Krieges gestorben, und dies
habe ihr Schicksal und das ihrer Familie aufs schwerste getroffen.
Hitler dagegen habe erklärt, er sei vier Jahre lang Soldat gewesen,
kenne das Elend des Krieges und habe erklärt, er werde dafür
sorgen, dass Deutschland nie wieder in einen Krieg verwickelt
werde.
Lotte Flügge (ehem. Cordes) über das Persönlichkeitsprofil
von Waltraud Steinweg, im Rückblick 1992:
Der Ausschluss aus dem BDM
Zur Datierung: In Siegen gab es eine prominente Nazi-Familie namens
Ring. Drei Schwestern, davon die eine Gauführerin des BDM (siehe
unten), eine andere mit dem Arzt Dr. Steinmetz in Plettenberg-Holthausen
verheiratet (vielleicht zunächst nur verlobt), tauchte also in
Plettenberg auf und kam auch zum BDM. Auch sie "schwärmte" für
Waltraud Steinweg (hat vermutlich entsprechende Berichte an ihre
Schwester in Siegen gegeben).
Der Ausschluss
Waltraud Steinweg bekommt eine offizielle Einladung des BDM-Gaus nach
Siegen, nicht näher bezeichneter Zweck, lediglich "wichtige Besprechung".
Dort wird sie von der Gauführerin Ring empfangen, die ihr eröffnet, sie
beabsichtige, sie (W. St.) zur Untergauführerin zu ernennen. Daraufhin
entspinnt sich folgender Dialog:
Waltraud Steinweg, überrascht, dann: "Das ehrt mich. Ich mache aber darauf
aufmerksam, dass ich mit einem Pastor der bekennenden Kirche verlobt bin
und wir irgendwann heiraten werden". (Das mit dem heiraten hatte noch seine
Weile: Lucas verdiente sehr wenig, auch nach seinem Examen 1936. Die
Heirat 1936 war unter finanziellen Gesichtspunkten immer noch ein großes
Risiko) Ring, wird bleich, dann: "Ach so, ja dann hat das ja gar keinen
Zweck. Ihr Verlobter wird Ihnen einen solchen Posten ja sicherlich nicht
erlauben!" Waltraud St.: "Oh, das hat nichts miteinander zu tun. Wir
haben uns gegenseitig alle Freiheiten gelassen!" Ring: "Sie werden von
mir hören!"
Einige Zeit nach dieser Unterredung bekommt Waltraud Steinweg einen langen
Brief des BDM. Ausführlich werden ihre Verdienste um die Bewegung
gewürdigt, vor allem in der "Kampfzeit". Dann aber: Nunmehr aber sei
sie auf eigenen Wunsch aus dem BDM ausgeschieden, was man mit Bedauern
zur Kenntnis nehme usw.. Waltraud Steinweg war über diesen "ehrenvollen
Rausschmiß" sehr traurig. Sie hat diesen Brief ihrem Bruder Reiner
gezeigt, der dazu sagte: " Da kann man gar nichts machen, es bleibt dir
nichts übrig als das hinzunehmen".
Untergauführerin wurde dann Lisbeth Vollmerhaus. Sie blieb bis 1945 eine
wichtige Funktionärin. Sie kam dafür nach Kriegsende in ein Gefangenenlager
für NS-Funktionäre in Staumühle, in dem verschärfte Bedingungen herrschten.
Der BDM Plettenberg
Tagungslokal:
Zur Datierung der Fotos:
1. Die ursprüngliche BDM-Kleidung war den "Luisen", d. h. den Frauen des
"Stahlhelm" nachempfunden. "Luisen" nach Königin Luise; deren Lieblingsblume
war die Kornblume, von daher ein blaues Kleid mit weißem Kragen, das vorn
geschnürt wurde. Statt von "Luisen" sprach man deshalb auch oft von "Kornblumen".
**Bei den "Luisen" konnte man nur Mitglied werden, wenn der Vater ein
"Stahlhelmer" war (zwingende Vorschrift). Bei Waltraud Steinweg hätte man
aber sicherlich eine Ausnahme gemacht, weil Vater an Folgen des Krieges
gestorben.
2. Der Ausschluss von Waltraud Steinweg aus dem BDM muss nach der "Röhm-Affäre",
also frühestens Mitte 1934 erfolgt sein. Das geht aus der Kontroverse zwischen
ihr und der BDM-Frau Ring hervor (siehe Zettel "einzelne Personen, Episoden").
Auf Fotos von BDM-Aktionen vor ihrem Ausschluss dagegen müsste sie wegen ihrer
Bedeutung in der Regel beteiligt sein.
Zu einzelnen Personen, Episoden
Tag der Machtergreifung;
Quelle: Wikipedia
Rang- und Dienststellungsabzeichen des BDM und JM (Jungmädel)
Neben den Rangabzeichen gab es außerdem Dienststellungsabzeichen in Form
von "Führerinnenschnüren":
Siehe auch "Deutsches Historisches Museum", Berlin: 1933-1939 Bund Deutscher Mädel (BDM)
|






 Reichsreferentin (1), Obergauführerin als Führerin eines Obergaues oder als
Amtsreferentin in der Reichsjugendführung (RJF) (2), BDM- und JM-Gauführerin
auch als Führerin eines Obergaues oder als Amtsreferentin in der RJF (3),
BDM- und JM-Untergauführerin auch als Führerin eines Obergaues oder als
Amtsreferentin in der RJF (4), BDM- und JM-Gauführerin (5), BDM- und
JM-Untergauführerin (6), BDM- und JM-Ringführerin (7), BDM- und
JM-Gruppenführerin (8).
Reichsreferentin (1), Obergauführerin als Führerin eines Obergaues oder als
Amtsreferentin in der Reichsjugendführung (RJF) (2), BDM- und JM-Gauführerin
auch als Führerin eines Obergaues oder als Amtsreferentin in der RJF (3),
BDM- und JM-Untergauführerin auch als Führerin eines Obergaues oder als
Amtsreferentin in der RJF (4), BDM- und JM-Gauführerin (5), BDM- und
JM-Untergauführerin (6), BDM- und JM-Ringführerin (7), BDM- und
JM-Gruppenführerin (8).