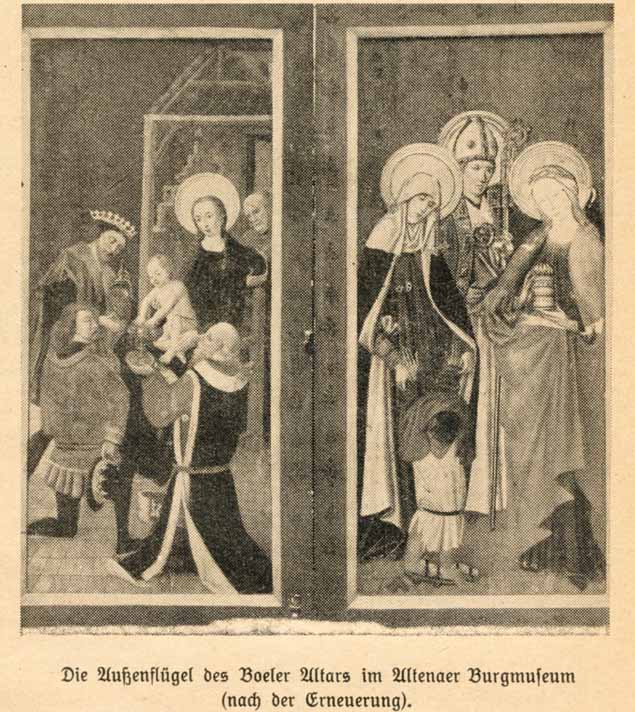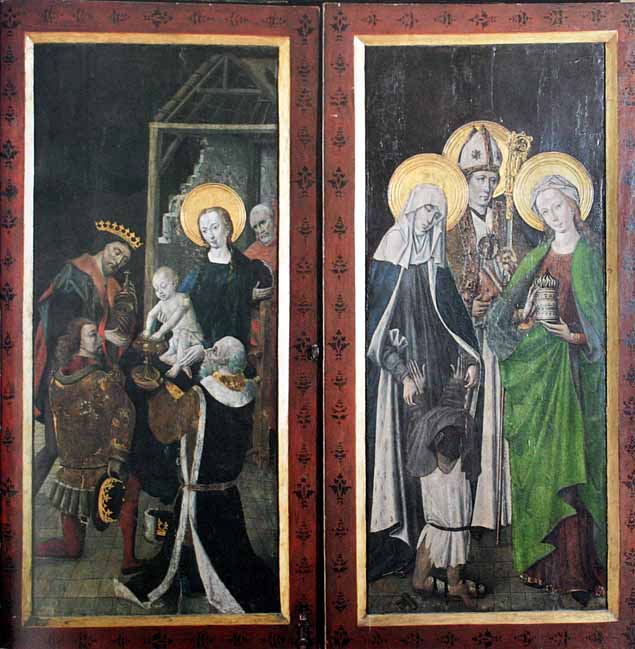|
Quelle: "Heimatbilder“, Beiträge zur Heimatkunde von Altena
und dem Süderlande, Ferdinand Schmidt, Archivar (Altena), Sonderdruck
aus den Jahrgängen 1939/40 des Altenaer Kreisblattes, S. 129-137
„Ein mittelalterliches Meisterwerk
„Unter den zahlreichen wertvollen Kunstschätzen unseres Burgmuseums
befindet sich seit Jahrzehnten in dem Kapellenraum ein dreiteiliger
Klappaltar, der aus der Nikolaus-Kapelle „auf dem Böhle“ in Plettenberg
stammt und seinerzeit in völlig verwahrlostem und darum für kirchliche Zwecke durchaus unbrauchbarem Zustande in Münster aufgefunden und erworben wurde.
Die beiden Außenflügel des Altars zeigen, wenn der Altar geschlossen
ist, links (vom Beschauer aus gesehen) eine Darstellung der Hl. Dreikönige,
rechts eine Gruppe von drei Heiligen: Elisabeth in Nonnenkleidung, die
einem armen Krüppel ein Obergewand überwirft; Maria Magdalena, erkenntlich
an dem Salbengefäß in ihren Händen, und zwischen diesen beiden einen
Bischof in reichem Gewande mit Mitra, Stab und Buch, den Hl. Gerhard
darstellend, dem diese Ehre als Namenspatron des Gründers der Kapelle
zufiel.
Die Außenflächen der beiden Flügel sind schon bald nach der Übernahme
des Altars in das Burgmuseum glücklich aufgefrischt und erneuert worden,
ohne dass man damals den Meister des Werkes erkannt hätte. Dem Beschauer
mussten die beiden Tafeln ohne weiteres durch ihre vollendete künstlerische
Meisterschaft auffallen, die auf einen bedeutenden Maler aus der zweiten
Hälfte des 15. Jahrhunderts schließen ließ.
Von einer Wiederinstandsetzung der inneren Flügelseiten und des Mittelfeldes
wurde damals abgesehen, weil nach fachmännischem Rate ihr arg beschädigter
Zustand bei dem damaligen Stande wohlverstandener Wiederherstellungskunst
einen nur einigermaßen lohnenden Erfolg solcher Erneuerungsbemühungen
kaum erwarten ließ, sondern die nicht unbeträchtlichen Kosten der
Auffrischung nicht zu rechtfertigen schien.
Der außergewöhnlich hohe künstlerische Wert der Außentafeln ließ aber
in dem kunstsinnigen Betreuer unseres Burgmuseums, Herrn Landrat a. D.
Geheimrat Thomee, im Vertrauen auf die Mithilfe seiner bewährten Gönner,
nunmehr doch den Entschluss reif werden, wenigstens einen Versuch der
Erneuerung und Auffrischung auch der Innentafeln des Altars machen zu
lassen, zumal das Landesmuseum der Provinz Westfalen in Münster in
dankenswerter Zusammenarbeit mit dem Provinzialkonservator neuerdings -
freudig begrüßt in allen Kreisen der praktischen Heimatpflege - eine
besondere Werkstatt für derartige Arbeiten eingerichtet hatte, in der
ähnlich stark verderbte Kunstwerke der Malerei und Plastik bereits mit
bestem Erfolge aufgefrischt, geradezu gerettet worden sind. War von den
alten Altarbildern wirklich noch etwas zu retten, so konnte das nur hier
durch den erfahrenen Fachmann, der unter der Aufsicht der Museumsleitung
nur nach den heute wieder durchgedrungenen strengen Grundsätzen musealer
Wiederherstellung und Erhaltung arbeitet, geschehen, ohne dass man noch
eine weitere Beschädigung der Bilder auch nicht durch früher so beliebte
Verschönerungen" zu befürchten brauchte.
So wurde denn der ganze Altar als augenscheinlich stark beschädigtes
Werk eines unbekannten Malers nach Münster geschickt, um nach mehreren
Monaten als ein in frischen Farben glänzendes Stück von der Hand des
Kölner "Meisters des Marienlebens", dessen Tätigkeit hauptsächlich
zwischen 1460 und 1480 lag, nach Altena zurückzukehren.
Bei der Untersuchung der alten Tafeln stellte sich zunächst heraus, dass
die ursprünglichen Bilder von einem Maler, dem jedes künstlerische Gefühl
gefehlt haben muss, hauptsächlich aus Gründen, die mit dem Glaubenswechsel
in Plettenberg um etwa 1570/80 zusammenhingen, stark überpinselt waren.
Auf allen drei Tafeln hatte er den Himmel im Hintergrunde der Darstellungen
gleichmäßig mit hellgrauer Farbe bedeckt, unter der er auch die goldstrahlenden
Heiligenscheine der dargestellten Personen hatte vollständig verschwinden
lassen. Nicht weniger war es ihm darum zu tun gewesen, die leuchtenden
priesterlichen Gewänder sowohl der Heiligen wie der drei Stifterfiguren
unkenntlich zu machen.
Einen dem hl. Hieronymus beigegebenen Löwen, der regelmäßig als dessen
"Attribut" auf bildlichen Darstellungen erscheint, hat er derart überschmiert,
dass nichts mehr davon zu sehen war. Schließlich hat er dem hl. Paulus
auf dem inneren rechten Flügel einen Petrus beifügen zu müssen geglaubt
und mit dessen roher Darstellung ein liebliches Bild der hl. Barbara verdeckt.
Es ist nun dem Restaurator in hohem Grade gelungen, diese Beschädigungen des
ursprünglichen Meisterwerkes wiedergutzumachen. Nachdem die Übermalungen,
die selbst schon wieder Jahrhunderte alt waren, in langwieriger Arbeit vorsichtig
entfernt waren, traten die früheren Farben wieder und Formen wieder klar hervor,
und wenn auch einzelne Stellen des Bildes, an denen die ursprünglichen Farben
im Laufe der langen Zeit durch Witterungs- und andere Einflüsse vollständig
verschwunden waren, nicht wieder hervorgezaubern werden konnten. So stören
diese leicht verdeckten Stellen doch heute kaum noch den wunderbaren Eindruck,
den die Tafeln in ihren aufgefrischten ursprünglichen Farben heute wieder auf
den Beschauer macht.
Betrachten wir zunächst das Mittelbild: eine Darstellung der Kreuzigung Christi.
Die hagere Figur des Heilandes gleicht sehr stark der Darstellung auf dem
Kreuzigungsbilde, das derselbe Meister im Auftrag des Kardinals Nicolaus von Cues
für die Hospitalkirche in dessen Heimatstadt an der Mosel malte. Links unter
dem Keuze die Gottesmutter in Schmerz versunken; der Lieblingsjünger Johannes
hält sie aufrecht; dahinter sieht man das Haupt der Maria Magdalena; ein Heiliger
mit Schwert (Apostel Jacobus?) schließt die Gruppe nach links ab. Unter dem
rechten Kreuzesarm eine Gruppe von zwei Kriegern, von denen der panzergerüstete
Hauptmann Longinus besonders hervortritt, einem Juden und nach rechts abschließend
dem hl. Hieronymus mit dem Löwen. Longinus erhebt die rechte Hand mit aufgereckten
Schwurfingern: "Wahrlich, dieses ist Gottes Sohn!" während der Jude ihn beim
Arme fasst, als wolle er sich dagegen wenden.
Zu den Füßen des Gekreuzigten knien drei Priester: die Stifter der Kapelle und
des Altars in priesterlicher Kleidung, einer im Chormantel, die beiden anderen
in Röchel und Stola. Nur zwei von ihnen konnten mit ihren lebenswahren Zügen unter
der Überpinselung hervorgeholt werden; das Gesicht des dritten ist in neutraler
Farbe nur notdürftig ergänzt worden.
Unter den Bischöfen auf dem linken Flügel ist der hl. Nikolaus, der Patron der
Kapelle, zu erkennen, der einem bettelnden Krüppel ein Almosen reicht; die hl.
Nonne mit Buch und Dornenkrone dürfen wir wohl als Darstellung der hl. Klara
ansprechen. Auf dem rechten Flügel ist die hl. Barbara mit dem Turme sicher zu
bestimmen; die Klosterfrau mit dem Krummstab stellt die hl. Äbtissin Gertrud
dar.
Aufbau und Farben der Bilder lassen mit Sicherheit darauf schließen, dass wir es
mit einem Werke des berühmten Kölner Künstlers zu tun haben, der in der
Kunstgeschichte als "Meister des Marienlebens" bekannt ist. In der Geschichte
der Kölner Malerschule steht dieser Meister "als die überragendste und fruchtbarste
Persönlichkeit in den Jahrzehnten nach der Mitte des 15. Jahrhunderts" da. Es
gibt kaum einen zweiten Meister dieser Zeit und Schule, von dem ein so umfangreiches
Werk zusamengestellt werden kann. Darum lässt sich auch von seinem Stil ein völlig
klares Bild gewinnen.
"Ruhig und feierlich ist der Eindruck seiner Bilder mit einem monumentalen Zug",
schreibt Dr. Heribert Reiners in seinem großen Werke über die "Kölner Meisterschule".
"Wie wenige andere hat er die Erzählung mit dem Repräsentations- und Andachtsbild
verbunden. Alles Schwere, Massige ist ferngeblieben, um die Stille nicht zu stören.
Daher auch die Weiträumigkeit seiner Bilder. Es ist viel Luft um seine Figuren in
großen Innenräumen und weiten Landschaften, nirgendwo etwas Beengendes, Drückendes.
Die Bewegung der Personen ist vom gleichen Geist, ruhig und gemessen; ihre Gebärden
sind ohne Lärm und Leidenschaft. Das gibt ihnen etwas Vornehmes und Würdevolles.
Im engsten Gefüge sind die Bilder aufgebaut. Die Gesamtkomposition ist von derselben
Klarheit und Strenge wie jede Einzelfigur. In der tektonischen Gestaltung gehört
der Meister zu den Besten der Schule. Sein Streben nach Einfachheit und Ruhe erklärt
die Vorliebe für zentrale Komposition . . . Was darüber hinaus den Bildern ihre
absolute Geschlossenheit gibt, ist die Wiederholung der tektonischen Grundfigur
selbst in jeder Einzelheit. Überall Zuspitzung der Form und Fläche, ein Begegnen der
Linien im Winkel, nirgendwo eine Rundung. Selbst der Kopftyp mit dem spitzen Kinn
erklärt sich so, auch die Vorliebe für die Köpfe mit den spitzen Bärten und die
Hervorkehrung der spitzen Schuhe.
Trotz des fast geometrischen Aufbaues bleiben Starre und Schematismus fern. Die
Bewegung der Figuren wirkt in der Gebundenheit doch frei und mannigfaltig, und
das Leben des Bildganzen ist stets von hohem Reichtum im Spiel der Linien und Flächen.
Bei aller Verwandtschaft in leichter Typisierung entbehren die Köpfe nicht des
Individuellen und der Beseelung.
Zum Verständnis der Bilder ist die Farbe unerlässlich. Sie erst gibt die letzte
Bindung, ergänzt die lineare Komposition und folgt denselben Grundformen der
Bildstruktur. Manche Ungleichwertigkeit mag durch Schüler- und Werkstatthilfe zu
erklären sein. Das Fraueninkarnat ist hell, fast weiß, leicht nur modelliert mit
rosa- und graufarbenen Tönen. Wie er dazu das Weiß von Kopf- und Halstuch stimmt,
wie er andere Farben zusammenstellt, vor allem Grau mit lichtem Grün, wie er in
den Tönen spielt, das alles deutet auf ein fein entwickeltes farbiges Empfinden.
Linie und Farbe sind dazu hier in der Wirkung völig ausgeglichen. Erst das Kolorit
gibt den Bildern ihre Flächenwirkung wieder. Das Streben nach plastischem Raum
musste dem Maler ebenso fern liegen, wie nach der plastisch-massigen Wirkung der
Einzelgestalt. Das sind die Stilelemente, soweit sie aus dem Hauptwerk, dem
Marienleben, abzuleiten sind." So Dr. Heribert Meiners.
Wenn der beste Kenner der kölnischen Malerei des Spätmittelalters diese Charakteristik
des alten Meisters der Folge der acht Bilder aus dem Leben der Gottesmutter abliest,
von denen sich sieben in der Alten Pinakothek in München und eins in der
Nationalgalerie in London befinden, so sehen wir sie Zug um Zug auf unseren
Altartafeln bestätigt.
Das Hauptbild der Kreuzigung ebenso wie die beiden Seitentafeln von innen zeigen
den strengen geometrischen Aufbau der Darstellung, wie ihn der Künstler liebte,
in geradezu klassischer Ausgeprägtheit. Man beachte, wie bei den beiden Gruppen
rechts und links unter dem Kreuz die vier Hauptfiguren sich genau entsprechen,
und ebenso auf den beiden inneren Seitentafeln links eine weibliche Heilige
zwischen zwei Bischöfen, rechts der Apostel Paulus zwischen zwei weiblichen
Heiligen nicht nur in sich selbst auf einander abgestimmt sind, sondern auch
bei geöffneten Tafeln dem ganzen Bilde ein sicheres, wohl ausgewogenes Gleichgewicht
geben.
Bei geschlossenen Flügeln erblickte man auf der rechten Seite nochmals eine ganz
ähnlich aufgebaute Gruppe von drei Heiligen: den hl. Gerhard zwischen St. Elisabeth
und Maria Magdalena. Natürlich konnte ein vollkommen entsprechender Aufbau in der
Darstellung der Anbetung der hl. Dreikönige auf der linken Außentafel nicht gegeben
werden. Hier bildet das Christusbild inhaltlich und malerisch den Mittelpunkt der
Darstellung; der Muttergottes entspricht ein stehend dargestellter König, während
die beiden anderen Weisen rechts und links vor dem Gottessohne knien - also auch
hier ein wohlüberlegter gleichmäßiger Aufbau der Handlung in engstem Gefüge.
Was die flächige Farbengebung betrifft, so ist diese auf der Schwarzweiß-Wiedergabe
naturlich nur schwach zu erkennen; aber auch in dieser Hinsicht tritt auf unseren
Altartafeln die Eigenart des Meisters klar in Erscheinung. Bis in die kleinen
Einzelheiten der spitzen Schnabelschuhe und des Kopftyps mit dem spitzen Kinn geben
unsere Bilder die Handschrift des Meisters des Marienlebens deutlich und unzweifelhaft
wieder.
Leider hat die Forschung unter den mehr als siebenzig Künstlernamen, die uns in Köln
aus der Zeit von etwa 1450 bis 1500 urkundlich überliefert sind, Namen und Person
unseres Malers bisher nicht feststellen können. Wir wissen, dass er mehrfach außerhalb
Kölns tätig war: außer dem Altar der Cueser Hospitalskapelle hat er auch für Linz a.
Rh. einen Altar geschaffen, der noch heute an Ort und Stelle steht. Dass er für den
Kardinal Nikolaus von Cues tätig war, zeugt von seinem großen Ansehen und
künstlerischen Ruf.
Ergänzung aus "Plettenberg - Industriestadt im märkische Sauerland, 1962, A. v.
Schwartzen, S. 129:
58849 Herscheid, Tel.: 02357/903090, E-Mail: info@plbg.de |